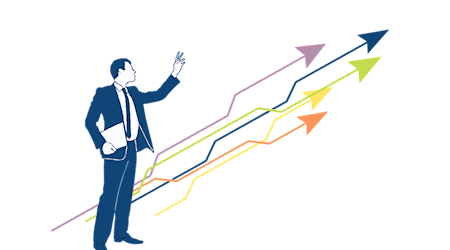Über 90 Prozent der etablierten Unternehmen wollen von Innovationen der Start-ups profitieren, Kooperationen zwischen Start-ups und Unternehmen liegen im Trend – doch die Gründer sehen auch Probleme.
Heute können Innovationen oftmals nicht mehr vollständig in Eigenregie realisiert werden – Unternehmen schauen daher verstärkt über Unternehmensgrenzen hinweg und versuchen, sich für externe Entwicklungen zu öffnen. Kooperationen stellen in diesem Zusammenhang ein vielversprechendes Instrument dar. Der Fokus für Kooperationsprojekte liegt tendenziell auf Kunden, Lieferanten, Universitäten und Forschungseinrichtungen als primäre Innovationspartner für Unternehmen. Treffen jedoch Start-ups und Mittelstand frühzeitig aufeinander, kann sich auch daraus eine fruchtbare Kooperation ergeben.
Das mittelständische Unternehmen profitiert von völlig neuen Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen, die aus der Kombination von eigenem Know-how mit dem Wissen des Start-ups entstehen können, und Start-ups lernen durch das Know-how des Mittelständlers potenzielle Kunden kennen.
»Generationenkonflikt« durch richtige Kooperation überwinden
Derartige Kooperationen sind allerdings auch schwierig zu gestalten – Unternehmenskultur, Unternehmensziele und Managementinstrumente unterscheiden sich dramatisch und so lässt sich durchaus ein »Generationenkonflikt« diagnostizieren, der oftmals die erfolgreiche Kooperation von jungen und alten, neuen und etablierten Spielern verhindert.
Wenn man über die Kooperation mit Start-ups spricht, ist es zunächst wichtig, dass sich beide Seiten verstehen. Das bedeutet, dass die betroffenen Personen die Umstände des jeweils anderen verstehen. Denn wie eine Studie der Universität Stuttgart-Hohenheim zeigt, sehen Gründer auch Probleme. Befragt wurden sie zu ihren Erfahrungen mit etablierten Firmen mit mehr als 500 Mitarbeitern – und heraus kamen ernüchternde Ergebnisse:
Start-ups
- vermissen die Augenhöhe,
- erleben, dass viele Versprechen nur Lippenbekenntnisse sind,
- machen zwiespältige Erfahrungen und
- fühlen sich oft nur als Mittel zum Zweck.
Etablierte Unternehmen bleiben in ihrer Zusammenarbeit mit Start-ups bei der operativen Realisierung von Kooperationen weiterhin unter Potenzial. Die besonderen Bedürfnisse von Start-ups werden immer noch nicht verstanden und Großunternehmen sind weit davon entfernt, als offen und kooperationsbereit wahrgenommen zu werden. Damit droht ihnen, erhebliches Innovationspotenzial zu verlieren. Und dies vollkommen unnötig, denn ein Engagement in einer Kooperation mit einem Start-up bindet nur begrenzt Ressourcen. Wer das Innovationspotenzial von Start-ups für sich nutzen will, muss grundsätzlich offener werden und sich eben auch an den Bedürfnissen von Start-ups ausrichten. Lokale Kooperation ist Pflicht, um global im Innovationswettbewerb bestehen zu können. Doch es gibt nicht nur Kritik, sondern auch konkrete Vorschläge, wie die Zusammenarbeit in Zukunft verbessert werden könnte. So plädiert die Hälfte der Befragten für die Einführung von konkreten Angeboten, auf denen Firmen und Start-ups zueinander finden können.
Der Ideenreichtum und die Wendigkeit von Start-ups sowie die Erfahrung und das Netzwerk bereits bestehender Unternehmen bergen viele Chancen für beide Welten. Aus der Überzeugung, dass dies ein großes Potenzial für die gesamte Wirtschaft bietet, plant die IHK Dresden gemeinsam mit Partnern die Aktion »KMU meets Start-up« (KMU = kleine und mittelständische Unternehmen). Interessierte Firmenchefs sind herzlich aufgerufen, daran teilzuhaben.
Welche Potenziale die Zusammenarbeit mit Start-ups bietet, erörtert eine aktuelle Studie des RKW-Kompetenzzentrums, die die Motive und Effekte der Zusammenarbeit zwischen Start-ups und Unternehmen untersucht hat.
Ein Teil der KMU ist bereits gut mit Start-ups verknüpft
Insgesamt kennen über die Hälfte der befragten Mittelständler Start-ups aus ihrem geschäftlichen Alltag, allerdings werden diese Kontakte nicht von jedem KMU genutzt. Einige von ihnen kommunizieren gar nicht mit Gründern. Dahingegen sind ein Viertel der KMU mindestens einmal im Monat im Austausch und mehr als ein Drittel hat bereits Kooperationserfahrungen mit Start-ups.
Technologien und Produktinnovationen stehen im Fokus
Hauptmotive für eine Kooperation sind die Weiterentwicklung von Produkten sowie der Einstieg in neue Märkte mit neuen Technologien. In der IKT-Branche reizt mehr als jedes zweite Unternehmen an der Zusammenarbeit auch die Chance, hierdurch hochqualifizierte potenzielle Mitarbeiter kennenlernen zu können. Insgesamt betrachtet, spielt die Möglichkeit, gemeinsam mit den Gründern neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, mit knapp über 50 Prozent ebenfalls eine bedeutende Rolle für das Eingehen einer Zusammenarbeit. Nur ein geringer Anteil sieht in Start-ups eine Investitionsmöglichkeit bzw. Möglichkeit für eine Beteiligung.
Persönliche Beziehungen sind ausschlaggebend
Eine im Vorfeld bestehende persönliche Beziehung zum Start-up-Gründer ist für mehr als die Hälfte der KMU eine wesentliche Grundbedingung für eine Zusammenarbeit. Zudem müssen die Startup-Gründer aus Sicht der meisten Mittelständler auch über keine langjährige Branchenerfahrung verfügen – für 80 Prozent stellt dies keinen Ausschlussgrund für eine Kooperation dar. Junge Gründer – unter 25 Jahren – haben jedoch aufgrund ihres Alters bei jedem vierten KMU einen schweren Stand.
Die Zusammenarbeit ist sehr erfolgreich
Um erfolgreich zu sein, sind vor einer Zusammenarbeit mit Start-ups Ziele festzulegen bzw. eine oder mehrere Zielkategorien herauszuarbeiten, zum Beispiel:
- Unternehmerisches Denken fördern: Die Zusammenarbeit mit Start-ups unterstützt die Entwicklung einer unternehmerischen Einstellung bei den Mitarbeitern, die mit agilen Teams, schlanken Ansätzen und einer frischen Denkweise konfrontiert werden.
- Innovationsimpulse gewinnen: Innovationen sind ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für Unternehmen. Start-ups bringen neue Technologien, Geschäftsmodelle und Talente »an den Tisch«. Hierdurch können neue Impulse für das eigene Unternehmen entstehen.
- Geschäftsprobleme lösen: Die Zusammenarbeit mit Start-ups kann zu alternativen Lösungen führen, die im Vergleich zu einer ausschließlich internen Vorgehensweise sowohl effizienter als auch innovativer sind.
- Zukunftsmärkte und neue Technologien erschließen: Start-ups können ein wichtiger Kanal für die Expansion von Geschäftsaktivitäten in neue Märkte sein und den Zugriff auf technologisches Know-how öffnen.
Insgesamt werden bei über 60 Prozent der Kooperationen die Ziele vollständig oder weitestgehend erreicht. 95 Prozent der KMU mit Start-up-Kooperationserfahrung würden auch in Zukunft erneut mit einem Start-up zusammenarbeiten. Bei kleineren KMU mit bis zu 50 Mitarbeitern ist die Bereitschaft für eine erneute Kooperation jedoch noch stärker ausgeprägt als bei größeren Mittelständlern.
Der Artikel erschien zuerst in: „ihk.wirtschaft“, Zeitschrift der IHK Dresden, Heft 4/2017
Autorin: Manuela Gogsch
Bild: IHK Dresden, mediaphotos, istock