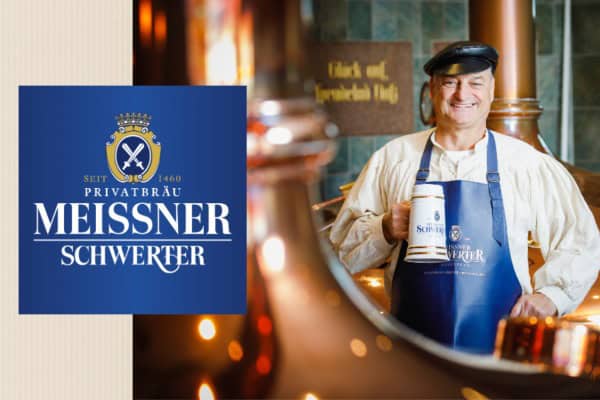Herr Krüger, Sie sind ehemaliger Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen. Sie haben auch mit V-Leuten im Bereich des Rechtsextremismus gearbeitet. Wie bewerten Sie die jüngste Einschätzung des VS zur AfD, die jetzt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist?
Zunächst einmal gestatten Sie mir einen kurzen Transparenzhinweis: Ich habe nach meinem Studium Mitte der 90er Jahre im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen sieben Jahre im operativen Bereich gearbeitet. Das ist zwar sehr lange her und viele organisatorische Abläufe haben sich sicherlich seit den 90er Jahren geändert. Die einzig entscheidende Ermächtigungsgrundlage, das Sächsische Verfassungsschutzgesetz vom 16. Oktober 1992, galt zumindest unverändert bis Mitte 2024.
Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass der Aufbau des LfV Sachsen sehr behutsam erfolgte, Transparenz und eine gewisse Offenheit standen damals aus gutem Grund zentral im Vordergrund. So wurde damals - obwohl aus nachrichtendienstlicher Sicht durchaus sinnvoll - ein Sichtschutz für den Parkplatz der privaten und Dienst-Kfz durch die Amtsspitze abgelehnt. Auch erschien es schwer, in Sachsen geeignete Bewerber für diese Behörde zu finden, zu tief waren die beklemmenden Erinnerungen an die Staatssicherheit der DDR, dem Schild und Schwert der Partei.
In den 90er Jahren gab es unzweifelhaft eine sehr starke rechts-extremistische, also gewaltbereite Szene in Sachsen. Diese mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu überwachen und zu bekämpfen, war wichtig, richtig und auch notwendig.
Bei der Beobachtung einer durch Artikel 21 GG besonders grundgesetzlich geschützten Partei sieht das allerdings etwas anders aus. Es muss deutlich erkennbar sein, dass eine Partei die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung anstrebt, dies muss sich aus den Zielen- also dem Parteiprogramm oder dem Verhalten ihrer Anhänger ergeben. Eine qualifizierte Bewertung ist natürlich erst durch die Veröffentlichung des Gutachtens möglich.
Voraussetzung für die Beobachtung ist gemäß § 4 Abs. 1 S. 3 Bundesverfassungsschutzgesetz das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für verfassungsschutzrelevante Bestrebungen oder Tätigkeiten. Erforderlich ist ein aktives Vorgehen zur Realisierung der verfassungsfeindlichen Ziele und ob die tatsächlichen Anhaltspunkte von hinreichendem Gewicht und in ausreichender Zahl sind. Bloß vereinzelte Entgleisungen einzelner Funktionsträger, Mitglieder oder Anhänger des Personenzusammenschlusses bzw. Partei genügen nicht. Bleibt abzuwarten, ob das AfD-Gutachten diesen Anforderungen entspricht.
Mir ist auch schleierhaft, wieso das BfV ein Geheimgutachten gegen eine Partei anfertigt, die das Gutachten aber selbst nicht einsehen darf und dazu entsprechend Stellung nehmen kann? „Audiatur et altera pars“ ist ein Grundsatz aus dem römischen Recht, welchem sich auch eine Verfassungsschutzbehörde nicht verweigern sollte, insbesondere wenn es sich um die stärkste Oppositionspartei im Land handelt. 1.108 Seiten Material können nicht alle Quellen geschützt sein.
Auf was beziehen sich die Ermittlungen des VS? Sind es öffentliche Aussagen von AfD-Mitgliedern oder Erkenntnissen von V-Leuten?
Das Gutachten ist nicht öffentlich zugänglich und müsste daher vermutlich gemäß §2 Absatz 2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz (Verschlusssachenanweisung - VSA) mindestens mit VS-NfD (Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch) wenn nicht gar noch höher eingestuft sein. Solch eine Einstufung erfolgt nur dann, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann. Warum der Spiegel dieses Gutachten einsehen konnte und wer das zu verantworten hat, ist für mich der eigentliche Skandal. Ein Nachrichtendienst, in dem klassifizierte Gutachten an Journalisten durchgestochen werden, hat ein massives Sicherheitsproblem und ich hoffe, dass die kommissarische Amtsspitze des BfV Strafanzeigen wegen Geheimnis- oder sogar Landesverrat- das beträfe dann die Journalisten, stellt. Vor zehn Jahren ermittelte gegen netzpolitik.org sogar der Generalbundesanwalt in einer ähnlichen Angelegenheit.
Die Beispiele, die im Spiegelartikel benannt werden, mögen in ihrer Tonalität und Pauschalität radikal klingen und ich möchte sie mir auch nicht zu eigen machen, dennoch beschreiben sie doch in Teilen die Situation in unserem Land und sind auch größtenteils von der Meinungsfreiheit gedeckt. Unkontrollierte illegale Migration führt nachweislich zur Verschlechterung der inneren Sicherheit und der Unwillen oder das Unvermögen 220.808 (Stand 31.12.2024) vollziehbar ausreisepflichtige Personen abzuschieben, führt zu Unverständnis und begründende Zweifel in die Handlungsfähigkeit der verantwortlichen Akteure.
Wenn die im Spiegel zitierten zugegeben radikalen Äußerungen von Parteimitgliedern und einzelnen Funktionären wirklich die Grundlage für die nun erfolgte Einstufung als gesichert rechtsextrem sein sollten, kann man darüber nur den Kopf schütteln, zumal es keine vorwerfbaren Zitate aus dem Parteiprogramm zu geben scheint. Besonders schockiert hat mich aber die in dem Artikel erwähnte Tatsache, dass Frau Faeser die Fachaufsicht, also die Wahrnehmung umfassender Informations- und Einwirkungsrechte und -pflichten! nicht ausgeübt hat. Zitat: „Die frühere Bundesinnenministerin Faeser ist mit ihrer Entscheidung, die Behördenbewertung öffentlich zu machen, ins Risiko gegangen. Eigentlich hatten die Fachleute ihres Ministeriums damit gerechnet, das 1.108 Seiten lange Gutachten noch einmal in Ruhe prüfen zu können. Das aber hätte mehrere Wochen gedauert. Die scheidende Ressortchefin drängte darauf, das Ergebnis sofort bekannt zu geben, ohne an der Analyse auch nur ein Komma ändern zu lassen.“
Dieses Verhalten kann ich nur mit dem am 5. Mai veröffentlichten Bild-Artikel von Filipp Piatov kommentieren: „Müsste der Verfassungsschutz ein Gutachten über Innenministerin Nancy Faeser anfertigen, würde die Einstufung wohl lauten: gesichert inkompetent.“
In meiner weiteren Bewertung möchte ich mich daher nur auf die öffentlich zugänglichen Pressemitteilung des BfV konzentrieren. Dort hat sich das Bundesamt hauptsächlich an “das in der Partei vorherrschende ethnisch-abstammungsmäßige Volksverständnis“ orientiert, welches nach der Auffassung des BfV „nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar“ sei. Wenn dies wirklich der zentrale Punkt der Einstufung ist, wäre das ohne Frage ein kühnes Unterfangen.
Das reguläre deutsche Staatsangehörigkeitsrecht beruhte bis 2000 ausschließlich auf das Abstammungsprinzip (Jus sanguinis) nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) vom 22. Juli 1913. Es war geprägt vom Konzept der Volksnation, das zum Ziel hatte, die Nation und das als ethnisch homogen vorgestellte deutsche Volk in Übereinstimmung zu bringen. Dieses Prinzip war also fast 90 Jahre Rechtslage in Deutschland. Ich selbst habe noch 1996 mein Staatsexamen geschrieben, bei dem es um das RuStAG ging.
Es war die rot-grüne Bundesregierung unter Schröder und Fischer, die das Jus sanguinis mit einem einfachen Parlamentsgesetz zu Fall brachte und damit letztendlich die Transformation der Volksnation zur Staatsbürgernation einleitete. Sollte das BfV das Festhalten am Abstammungsprinzip mit einem Volksbegriff, der seit der Gründung der Bunderepublik bis Ende 1999 noch gängige Rechtslage war, zu einer verfassungsfeindlichen Bestrebung umdeuten, wäre dies sicherlich gerade vor den rechtlichen Normen des Bundesvertriebenengesetzes und Artikel 116 Abs.1 GG schwer nachzuvollziehen.
Inwieweit Erkenntnisse durch Vertrauensleute (V-Leute) Grundlage für die erfolgte Einstufung bilden, entzieht sich meiner Kenntnis. Es ist aber stark anzunehmen, dass die Verwendung von nachrichtendienstlichen Mitteln, was dem Verfassungsschutz seit der Einstufung der AfD als Verdachtsfall schon möglich ist, auch angewandt werden. Vielleicht liegt auch hier der Grund, weswegen die 1.108 Seiten Gutachten nicht sofort veröffentlicht werden können, sondern noch entsprechend gesichtet und entsprechend bearbeitet werden müssen.
Der Einsatz von V-Leuten wäre aber gem. § 9b i. V. m. §9a BVerfSchG unzulässig, wenn die Informationsgewinnung auch auf weniger beeinträchtigende Weise erfolgen könnte.
Die Gründungsväter der Bundesrepublik haben dem VS aus guten historischen Gründen nur eingeschränkte Befugnisse gegeben. Er ist keine Gestapo oder Stasi, hat keine Polizeigewalt und darf auch keine Partei verbieten. Das darf überhaupt kein Politiker, er könnte ja einen politischen Konkurrenten entfernen. Was wird also passieren?
Die Trennung von Polizei- und Verfassungsschutzbehörden sollte trotz der damit verbundenen Einschränkungen unbedingt bestehen bleiben. Auch wenn der Verfassungsschutz keine unmittelbaren exekutiven Möglichkeiten hat, so ist dennoch seine Tätigkeit von Belang, insbesondere wenn es um Extremismusbekämpfung und vor allem der gegenwärtig an Bedeutung zunehmende Spionageabwehr geht- Darauf sollten die Verfassungsschutzbehörden der 2020er Jahre vor allem ihren Fokus setzen.
Schwieriger wird die Sache, wenn es um die Einstufung als „gesichert rechts- oder linksextrem“ durch den Verfassungsschutz bei politischen Parteien geht. Bewirkt so eine Bewertung - begründet oder nicht - zunächst einmal, dass die entsprechende Partei oder Gruppierung aus dem demokratischen Diskurs entrückt, quasi zu politischen Paria erklärt wird. Da hier der Verfassungsschutz einer gewissen Gewaltenverschränkung unterliegt und Parteien gem. Artikel 21 GG dem Parteienprivileg unterliegen, ist besondere dann Um- und Vorsicht geboten, wenn sich der Beobachtungsfokus auf Parteien bezieht, die im Parlament vertreten sind und - wie derzeit im Falle der AfD - sogar die stärkste Oppositionspartei bilden.
Das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen (§ 4 Absatz 2a BVerfSchG) und das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition (§ 4 Absatz 2c BVerfSchG) sind zwei wesentliche Säulen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, die einer Beobachtung einer Oppositionspartei durch den Verfassungsschutz sogar entgegenstehen könnten.
Ein Parteiverbot - und darauf läuft die ganze Sache nach meiner Überzeugung wohl hinaus - erfordert nach dem NPD-Verbotsurteil ein „Ausgehen“ auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Es ist kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot. Vielmehr muss die Partei über das Bekennen ihrer verfassungsfeindlichen Ziele hinaus die Grenze zum Bekämpfen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung überschreiten. Dies setzt voraus, dass sie sich durch aktives und planvolles Handeln für ihre Ziele einsetzt und auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung hinwirkt. Es müssen jedoch konkrete Anhaltspunkte von Gewicht vorliegen, die es zumindest möglich erscheinen lassen, dass das Handeln der Partei erfolgreich sein kann (Potentialität). Lässt das Handeln einer Partei dagegen noch nicht einmal auf die Möglichkeit eines Erreichens ihrer verfassungsfeindlichen Ziele schließen, bedarf es des präventiven Schutzes der Verfassung durch ein Parteiverbot nicht.
Gibt es weltweit eigentlich Vergleichbares wie den VS?
Soweit mir bekannt, hat nur Österreich mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) eine strukturell vergleichbare Behörde, für die aber öffentliche Äußerungen über Parteien grundsätzlich nicht vorgesehen sind. Selbstverständlich verfügen auch andere Staaten über Inlandsnachrichtendienste, die für Extremismus- und Spionageabwehr zuständig sind, sowie ihren Regierungen ein aktuelles Sicherheitslagebild verschaffen.
Bei der Beobachtung von politischen Parteien durch Inlandsgeheimdienste ist die Situation eine andere. Ich empfehle da die Lektüre des Berichtes des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages „Die Beobachtung politischer Parteien durch Inlandsnachrichtendienste in anderen europäischen Staaten der EU“ (WD 3 - 3000 - 032/21). Dieser Bericht befasst sich mit der Beobachtung politischer Parteien durch Inlandsnachrichtendienste in Frankreich, Italien, Österreich, Polen, Schweden, Spanien und Ungarn.
Extremismusabwehr ist in einer Demokratie sicher sehr wichtig, wird sogar immer wichtiger, oder?
Absolut, Rechts- Links und religiöser Extremismus und Terrorismus sind zweifellos elementare Tätigkeitsfelder, insbesondere bei der Spionageabwehr sehe ich ein wichtiges Betätigungsfeld der Verfassungsschutzbehörden. Umso fragwürdiger ist es, wieso der Verfassungsschutz seit der Coronapandemie einen neuen Phänomenbereich „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ geschaffen hat. Dieser neu erschaffene Phänomenbereich ist bisher weder trennscharf definiert noch begrifflich einheitlich genügend klar abgegrenzt worden, sodass für viele Bürger diese Beobachtungandrohung viel zu diffus und eher missverständlich aufgefasst werden könnte. Indifferente Begrifflichkeiten sind aber insbesondere bei einem Nachrichtendienst mit seinen tiefgreifenden grundrechtsbeeinträchtigenden Möglichkeiten zu vermeiden, da sie nicht nur missverständlich ausgelegt werden, sondern den Bürger in der Ausübung seiner verfassungsgemäß zustehenden Grundrechte beeinträchtigen könnte.
Das wird in erster Linie dadurch deutlich, da es innerhalb der Landesämter für Verfassungsschutz, als auch im Bundesamt für Verfassungsschutz, völlig unterschiedliche und sich ändernde Definitionen für denselben Phänomenbereich gibt.
Mag diese handwerklich fragwürdige rechtliche Einordnung dieses Begriffes und die daraus erwachsenen Ermächtigungsgrundlage während der Coronapandemie vielleicht noch begründet gewesen sein, so erscheint es aus heutiger Betrachtung schwer nachvollziehbar, warum dieser aus rechtstaatlicher Sicht schwer fassbare Phänomenbereich drei Jahre nach dem Ende der Pandemie sich fest im Fokus des Bundesamtes und der Landesämter mit unterschiedlichen Definitionen etabliert hat.
So heißt es beispielweise auf Seite 119 des Verfassungsschutzberichtes des BfV von 2021 unter III Gefährdungspotential: „Die Angehörigen des Phänomenbereichs versuchen, das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie, in staatliche Institutionen sowie in Wissenschaft und Medien zu untergraben.“ Medienkritik ist verfassungsfeindlich? Geht’s noch?
Für mich hat der Verfassungsschutz seit der dauerhaften Etablierung dieses Phänomenbereiches seine Unschuld verloren.
Am Ende muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Könnte es wieder ein Problem mit diesen V-Leuten geben, dass allein daran ein Verbot scheitert?
Das entzieht sich meiner Kenntnis und ich möchte hier auch nicht spekulieren. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass mein Vertrauen in die politische Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts bei dem derzeitig amtierenden Präsidenten als ehemaliges Mitglied des CDU-Bundesvorstands und ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, nicht sonderlich hoch ausgeprägt ist, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Was sollte die neue Regierung im Umgang mit der AfD anders machen?
Zunächst einmal würde ich mir viel mehr Gelassenheit im Umgang mit der AfD wünschen, ob es einem passt oder nicht, sie ist ein fester Bestandteil im Parlamentsbetrieb und wird es - schaut man sich das Wählerpotential an - auch weiterhin bleiben.
Gerade im Hinblick auf die großen Herausforderungen in der Extremismusbekämpfung und der Spionageabwehr sollten die Ressourcen bei den Verfassungsschutzämtern des Bundes und der Länder konzentriert an diesen Stellen eingesetzt werden, anstatt sich an der stärksten Oppositionspartei abzuarbeiten. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Bürger das Vertrauen in die seriöse Arbeitsweise der Verfassungsschutzbehörden verlieren könnten, sofern das nicht schon bei einem Großteil geschehen ist. Immerhin hat das LfV Sachsen den AfD-Landesverband bereits im Dezember 2023 als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft, ohne dass dies Einfluss auf die Wahlergebnisse gehabt hätte. (37,3 Prozent beim Zweitstimmenergebnis bei der Bundestagswahl 2025 in Sachsen)
Die Stärke der AfD erklärt sich in erster Linie mit der Schwäche der anderen Parteien in vielen Politikfeldern, vor allem aber in der ungelösten und weiterhin zuspitzenden Migrationsfrage.
Mit der gegenwärtig stattfindenden dauerhaften Ausgrenzung der AfD erreicht man nur, dass sich die Partei in einer Märtyrerrolle inszenieren kann. Warum wird sie nicht mehr in Gremien und Entscheidungsprozesse eingebunden? Warum versteht die CDU nicht, dass die Aufrechterhaltung der „Brandmauer“ auf ihre Kosten geht und nur ein Konstrukt ist, was es einer Minderheit ermöglicht, weiterhin Macht und Einfluss ausüben zu können?
In einer freiheitlichen Gesellschaft sollte man aber eine Oppositionspartei nicht „wegverbieten“, sondern mit guter Regierungsarbeit „wegregieren“.
Die Fragen stellte Ulf Mallek.
Inzwischen haben einige Medien, so Cicero.de, das Gutachten in voller Länge veröffentlich.