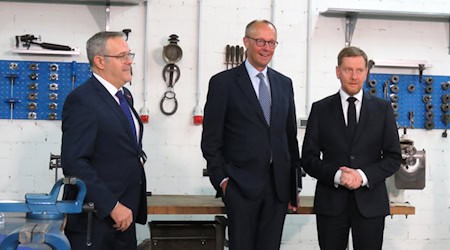Die Debatte um die Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz, wonach es im „Stadtbild“ deutscher Städte noch ein „Problem“ gebe, ist mehr als nur Rhetorik. Sie berührt Fragen nach Verantwortung, Integration und dem gesellschaftlichen Klima in deutschen Städten. Merz hatte im Rahmen einer Pressekonferenz erklärt, „im Stadtbild“ bestehe „noch dieses Problem“, weshalb der Bundesinnenminister dabei sei, Rückführungen in größerem Umfang voranzutreiben. Auf Nachfrage verwies er kryptisch auf die Perspektive von „Töchtern“, die angeblich genau wüssten, was gemeint sei, und lieferte damit weiteren Interpretationsraum. Später betonte er, Menschen mit Migrationshintergrund seien unverzichtbar für den Arbeitsmarkt; gemeint seien vielmehr solche, die ohne Arbeit, Aufenthaltsstatus und Regelbindung im öffentlichen Raum lebten.
Zustimmung erfährt Merz vor allem, weil viele Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass sich soziale Probleme in (Groß-)Städten sichtbar verdichten. Es gibt Menschen, die sich an bestimmten Orten fremd im eigenen Land fühlen. Dieses soll und muss ernst genommen werden. Das Politbarometer zeigt, dass Teile der Bevölkerung seine Aussage nachvollziehen kann und sich durch sie ernst genommen fühlt. Diese Wahrnehmung, gekoppelt an den Wunsch nach mehr Sicherheit und Ordnung, erzeugt ein politisches Echo. Befürwortende Stimmen interpretieren Merz’ Worte als Versuch, Missstände offen anzusprechen, die in manchen Straßenzügen sichtbar sind, und dabei nicht um den Kern herumzureden.
Natürlich lässt der Begriff „Stadtbild“ offen, ob von Gebäuden, Verhalten oder schlicht Menschen die Rede ist. Diese Unschärfe öffnet Raum für Spekulationen. Vermutlich sind auch nicht die Stadtbilder von Kamenz, Radeberg oder Pulsnitz gemeint, eher die von Berlin und anderen Großstädten. Die Debatte offenbart letztlich einen Grundkonflikt unserer Zeit. Unsere Städte haben mit den Folgen sozialer und wirtschaftlicher Belastungen durch Zuwanderung zu kämpfen, und Bürger erwarten, dass die Politik diese erkennt und adressiert. Merz’ Aussage trifft den Nerv vieler, doch sie sendet eben auch ein Signal, das leicht missverstanden werden kann und im Zweifel eher trennt als verbindet.
Ein Kanzler sollte nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungen formulieren, die Integration fördern, Sicherheit schaffen und Teilhabe ermöglichen. Die Frage, wie Deutschland lebenswert und gerecht gestaltet werden kann, entscheidet sich letztlich nicht an der Optik eines „Stadtbilds“, sondern am Umgang mit den Menschen, die hier leben, auch und gerade den Einheimischen.
Was bei der Diskussion um die „Stadtbild“-Aussagen des Bundeskanzlers nicht vergessen werden darf: Sie lenkt ab von den für uns alle viel wichtigeren Fragen um Aufrüstung, Kriegstüchtigkeit und Wehrpflicht. Vielleicht wollte Friedrich Merz auch nur eins erreichen: von dieser drängenden Problematik gekonnt ablenken.