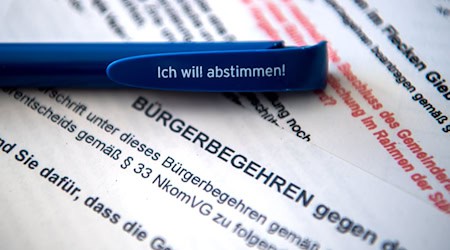Eine Studie hat ergeben, dass sich der Anteil psychisch kranker Kinder und Jugendlicher in Sachsen während der Corona-Pandemie nicht signifikant erhöht hat. Allerdings fällt die Entwicklung bei Mädchen und Jungen unterschiedlich aus. Die vom sächsischen Sozialministerium in Auftrag gegebene Studie wurde am Dienstag in Dresden veröffentlicht, sie war Ende 2021 in Auftrag gegeben worden.
Die Studie konzentrierte sich auf psychisch kranke Kinder und Jugendliche von 10 bis 16 Jahren, die behandelt wurden. Ausgewertet wurden anonymisierte Diagnosen, die zwischen Anfang 2018 und Ende 2021 bei den gesetzlichen Krankenkassen in Sachsen eingereicht wurden. Zudem wurden Experteninterviews durchgeführt und bewertet.
Laut Studie stieg die Inzidenz, also die Zahl von Neu-Erkrankten, bei Mädchen in den Quartalen nach Pandemiebeginn von durchschnittlich 3,1 Prozent auf 3,3 Prozent an. Dies entspreche einem Anstieg um 7 Prozent bei Mädchen mit einer psychischen Erkrankung. Besonders auffällig war die Altersgruppe der 15- bis 16-Jährigen, bei denen die Zahl von Neuerkrankungen psychischer Natur um 9 Prozent stieg. Bei Jungen hingegen fiel die Inzidenz nach Pandemiebeginn von 2,9 Prozent auf 2,8 Prozent.
Bei genauerer Betrachtung konnte festgestellt werden, dass es zudem zu einer Verschiebung von Diagnosen bei Depressionen, Angststörungen und Essstörungen kam - vor allem bei Mädchen. Bei Jungen gab es laut der Studie keine signifikanten Veränderungen.
Vor Beginn der Pandemie lag die Prävalenz der depressiven Episode bei Mädchen bei 1,0 Prozent. Nach Beginn der Pandemie soll sie auf durchschnittlich 1,2 Prozent gestiegen sein. In absoluten Zahlen entspreche dies etwa 230 zusätzliche Mädchen mit der Diagnose. Bei Essstörungen waren es etwa 130 zusätzliche Mädchen.
Bei anderen psychischen Erkrankungen gab es einen Rückgang, beispielsweise bei hyperkinetischen Störungen - dazu zählen unter anderem Aufmerksamkeitsstörungen. Der Studie zufolge betraf dies vor allem Jungen im Alter zwischen 10 bis 11 Jahren. Demnach wurde vor der Pandemie bei 7,6 Prozent aller Jungen eine hyperkinetische Störung diagnostiziert. Während der Pandemie lag der Wert bei 6,9 Prozent. Da derartige Erkrankungen häufig im Schulkontext erkannt und diagnostiziert werden, gehen die Experten davon aus, dass der Rückgang auf die Schulschließungen beziehungsweise den Wechselunterricht zurückzuführen ist.
«Die Studie wirft ein Licht auf die erkrankten Kinder. Und diese müssen wir besonders in den Fokus nehmen. Kein Kind darf vergessen werden», sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Hinter jeder Zahl, jeder Diagnose, stecke eine Schicksal, eine betroffene Familie, eine betroffene Schulklasse. Corona habe ohne Frage Kindern und Jugendlichen viel abverlangt.
Die Experten betonten die zunehmende Schwere der Erkrankungen und die Bedeutung von Prävention und niedrigschwelligen Maßnahmen, vor allem im schulischen Bereich. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) räumte zudem einige Fehler während der Pandemie ein. «Kinder und Jugendliche wurden zu lange in ihrer persönlichen und schulischen Entwicklung zum Schutz der Alten und vulnerablen Gruppen eingeschränkt. Das bedaure ich sehr.» Die Schließungen von Kitas und Schulen habe Folgen für die seelische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen nach sich gezogen, die gravierender als die entstandenen Bildungslücken seien.
Piwarz verwies darauf, dass präventive Maßnahmen an den Schulen ausgebaut werden, um die Früherkennung von psychischen Problemlagen bei Schülern und das allgemeine Bewusstsein für die psychische Gesundheit zu stärken. So soll beispielsweise die Zahl der Schulpsychologen von derzeit 58 auf 109 fast verdoppelt werden.
«Um es klar zu sagen: Wir Erwachsenen haben den Kindern viel abverlangt. Vielleicht auch zu viel», sagte die SPD-Politikerin Juliane Pfeil mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen. Nun sei wichtig, aus der Pandemie die richtigen Lehren zu ziehen. Dazu gehörten auch gute Unterstützungsangebote in den Schulen.
Auch die Krankenkasse DAK-Gesundheit mahnte zur Vorsicht. «Im zweiten Corona-Jahr kamen insgesamt weniger Kinder und Jugendliche in Sachsens Arztpraxen und Krankenhäuser als vor der Pandemie - sowohl zu Behandlungen als auch zur Vorsorge.» Die DAK sehe hier einen Zusammenhang mit den rückläufigen Erstdiagnosen bei bestimmten psychischen Erkrankungen. Auch wenn diese Erkrankungen während der Pandemie seltener diagnostiziert wurden, sei die Krankheitslast bei Kindern und Jugendlichen nicht weniger geworden.
Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten