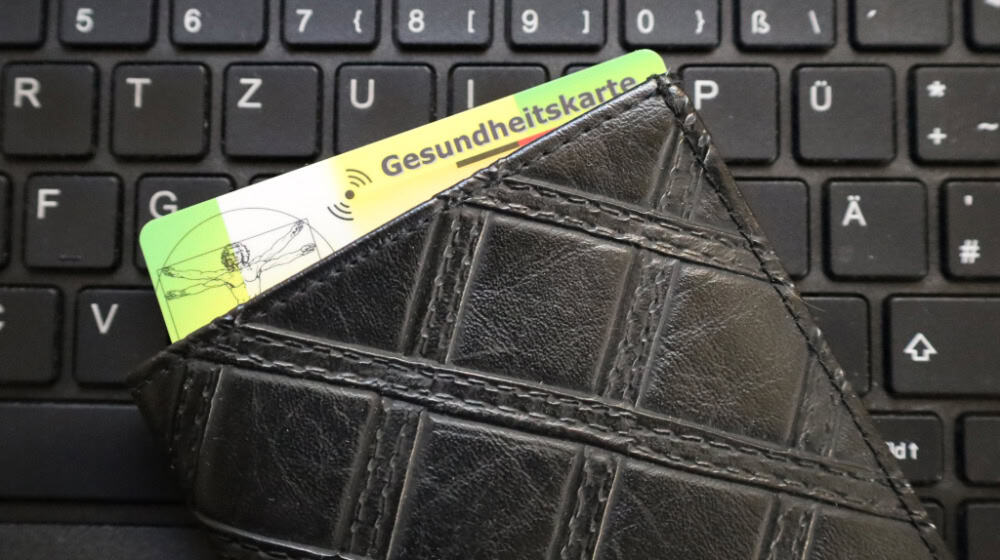Im Jahr 2025 ist für alle gesetzlich Versicherten, die dem nicht widersprochen haben, eine elektronische Patientenakte (ePA) eingerichtet worden.
Sie gilt als Herzstück der Digitalisierung im Gesundheitswesen und soll die medizinische Versorgung moderner und effizienter machen. Bisher wird die ePA jedoch kaum genutzt. So haben beispielsweise bei den elf deutschen AOK’s mit über 25 Mio. eingerichteten ePA’s nur gut 200.000 Versicherte eine Gesundheits-ID als Zugangsvoraussetzung angelegt.
Die Idee hinter der ePA ist einfach: Statt medizinische Informationen über verschiedene Arztpraxen, Kliniken und Papierakten zu verteilen, sollen alle relevanten Daten an einem digitalen Ort gebündelt werden. Ob Laborbefunde, Befundberichte bildgebender Diagnostik, Arztbriefe oder Medikationspläne, künftig sollen behandelnde Ärzte mit Zustimmung der Patienten direkt darauf zugreifen können. Das erleichtert nicht nur die Diagnose und Therapie, sondern kann im Notfall sogar lebensrettend sein, wenn Informationen sofort zur Verfügung stehen. Zusätzlich und quasi freiwillig können Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Pflegedaten, Reha-Maßnahmen und Angaben zur Organspende hinterlegt werden.
Zudem verspricht die ePA eine Entlastung im Alltag medizinischer Einrichtungen: weniger Bürokratie, weniger Doppeluntersuchungen, weniger Papierchaos. Auch Patienten erhalten mehr Transparenz, können nachvollziehen, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat und behalten die Kontrolle, was gespeichert wird.
Ein praktisches Problem bleibt jedoch. Die meisten bisherigen Gesundheitsdaten liegen nicht digital vor, sondern in Papierakten oder in dezentralen Computersystemen. Um diese Informationen in die ePA zu überführen, müssen sie eingescannt oder manuell übertragen werden, ein zusätzlicher Aufwand, den Praxen und Kliniken kaum leisten können. Damit droht die elektronische Akte zunächst ziemlich unvollständig zu bleiben. Versicherte können über ihre Krankenkasse bis zu zehn ältere Dokumente digitalisieren und in die ePA übertragen lassen. Das ist zwei Mal innerhalb von zwei Jahren möglich ist. Oder sie machen sich die Mühe, ihre Arztbriefe selbst zu scannen und einzustellen.
Leider ist es aktuell noch nicht möglich, die Ergebnisse bildgebender Diagnoseverfahren wie CT und MRT in der ePA zu hinterlegen. Offenbar gibt es noch Probleme aufgrund des Umfangs der Daten. Auch der Impfpass ist derzeit nicht ePA-fähig und somit nur als Scan einzufügen, was wenig praktikabel ist. Nach jeder Impfung müsste dann ein neuer Scan erstellte werden.
Vertrauen ist gut – Kontrolle auch
Die ePA wirft auch Fragen zum Schutz sensibler Daten auf. Zwar sind die Inhalte verschlüsselt und der Zugriff kann individuell gesteuert werden. Versicherte entscheiden, wer welche Daten einsehen darf und für welchen Zeitraum. Trotzdem warnen Datenschützer vor möglichen Sicherheitsrisiken. Kein System sei vollkommen sicher, und gerade bei Gesundheitsdaten könnten Datenlecks oder Missbrauch gravierende Folgen haben. Besonders kritisch wird auch gesehen, dass Ältere oder technisch weniger versierte Personen Schwierigkeiten haben könnten, ihre Rechte tatsächlich wahrzunehmen.
Ärzte haben nach Einlesen der Gesundheitskarte für neunzig Tage Zugriff auf die ePA, Apotheken drei Tage. Derzeit können Versicherte über eine Smartphone-App zwar steuern, welcher Arzt Zugriff zur ePA hat, aber sie haben aktuell keine Möglichkeit, einzelne Dokumente vom Zugriff auszunehmen. Da bedeutet, dass man einem Arzt den Zugang erteilt oder nicht. Hat er ihn, sieht er alles.
ePA-Einrichtung auf dem Smartphone
Versicherte benötigen ein Gerät mit mindestens iOS V16 oder Android V9. Das Smartphone muss NFC-fähig sein, um Kartendaten zu lesen. Außerdem muss der Versicherte eine Mailadresse besitzen. Zur Identifikation ist eine Gesundheitskarte mit PIN oder der Personalausweis mit PIN Voraussetzung. Alternativ kann das PostIdent-Verfahren genutzt werden. Die PIN zur Gesundheitskarte muss der Krankenkasse angefordert werden. Dafür muss der Versicherte persönlich vorsprechen und seinen Personalausweis mitbringen.
Im ersten Schritt müssen beispielsweise AOK-Versicherte die Apps „AOK Mein Leben“ und „AOK-Ident“ heruntergeladen werden. Die Einrichtung erfolgt nur über die erstere, wobei von dieser aus die zweite zwischenzeitlich zur Erstellung einer „Gesundheits-ID“ und zur Prüfung der Identifikation aufgerufen wird. Der Nutzer wird durch den Einrichtungsvorgang geleitet, wobei man sich ein wenig Zeit nehmen und die Meldungen der App aufmerksam lesen sollte.
Weniger technikaffine Menschen sollten sich gegebenenfalls helfen lassen. Zudem besteht die Möglichkeit, die eigene ePA für andere freizugeben. Das ist sinnvoll, wenn Senioren ihre Kinder mit der Pflege der Rechte an ihren Gesundheitsdaten beauftragen wollen oder Eltern dies für ihre minderjährigen Kinder tun wollen. Auch können sich Ehepartner gegenseitig berechtigen.
Die elektronische Patientenakte hat zweifellos das Potenzial, die Gesundheitsversorgung entscheidend zu verbessern. Sie kann den Austausch zwischen Ärzten vereinfachen, Doppeluntersuchungen vermeiden und Diagnosen beschleunigen. Zudem sorgt sie für mehr Transparenz und ermöglicht Versicherten eine aktivere Rolle im Umgang mit ihren Gesundheitsdaten. Beim derzeit technisch Machbaren ist aber noch deutlich Luft nach oben.