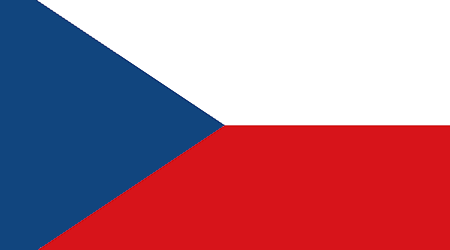Viele Eltern und Jugendliche kennen vor allem das Schlagwort „Hotel Mama“ – weniger bekannt ist, dass das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) schon seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Mitarbeitspflicht der Kinder kennt. § 1619 BGB („Dienstleistungen in Haus und Geschäft“) räumt Eltern zwar keinen Freibrief zur Ausbeutung ein, enthält aber eine klare Erwartung: Wer zum elterlichen Hausstand gehört und von den Eltern versorgt wird, soll sich im Alltag einbringen.
Was im Gesetz steht
Der Gesetzestext ist kurz: Das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, „in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten“.
Der Begriff „Kind“ ist juristisch weit zu verstehen. Nach der Rechtsprechung gilt die Dienstpflicht für minderjährige und volljährige Kinder ebenso wie für Stief‑ und Pflegekinder. Die Pflicht endet erst, wenn das Kind auszieht oder seinen Lebensunterhalt selbst bestreitet.
Die Vorschrift richtet sich damit an Kinder, die von ihren Eltern wirtschaftlich abhängig sind. Der Bundesgerichtshof entschied, dass kein Raum für eine Dienstleistungspflicht mehr besteht, wenn das Kind seine volle Arbeitskraft in eine eigene Erwerbstätigkeit investiert. Außerdem ist § 1619 BGB an die Unterhaltspflicht der Eltern gekoppelt: Der Anspruch entfällt, wenn der Unterhalt der Eltern nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.
Kein Recht auf Lohn – aber auch keine Sklavenarbeit
Der Gesetzgeber hat bewusst keine starre Stundenzahl festgelegt. Eine frühere Entscheidung des Bundesgerichtshofs hielt für Jugendliche über 14 Jahren sieben Wochenstunden Mithilfe für vertretbar. Juristische Literatur und die Rechtsprechung nennen bei Zwölfjährigen Richtwerte von 3,5 bis 7 Stunden pro Woche; bei älteren Teenagern gelten 7 bis 8 Stunden als zumutbar. Diese Angaben sind Richtwerte, keine gesetzlichen Pflichtstunden. Entscheidend ist, dass die Mithilfe zur körperlichen, geistigen und seelischen Reife passt und Schule oder Ausbildung nicht beeinträchtigt werden. Für volljährige Kinder gilt das Gleiche: Sie müssen sich nur beteiligen, wenn sie noch wesentlich von den Eltern unterhalten werden.
Ebenso wenig entsteht aus der Mithilfe ein Anspruch auf Lohn. Der Haufe‑Kommentar stellt klar, dass § 1619 BGB vor allem in zwei Fällen praktisch wird: Bei Schadensersatzansprüchen wegen entgangener Dienste und bei erbrechtlicher Belohnung für umfangreiche Mitarbeit. Als Vehikel zur Einforderung häuslicher Mithilfe im Alltag wird die Vorschrift als „nicht zeitgemäß“ empfunden. Kleinere Hilfstätigkeiten wie Tischdecken, Geschirrspüler aus‑ und einräumen oder den Müll hinausbringen lösen keinen Vergütungsanspruch aus; als Anerkennung kann aber Taschengeld gezahlt werden.
Welche Aufgaben sind gemeint?
§ 1619 BGB spricht nicht nur vom „Hauswesen“, sondern auch vom „Geschäft“. Erfasst sind daher alle Tätigkeiten, die im elterlichen Haushalt oder im Betrieb anfallen. Die OrgaMAX‑Fachinformation weist darauf hin, dass die Pflicht nicht nur das eigene Zimmer betrifft, sondern auch das Ladengeschäft, die Werkstatt oder das Büro. Der Umfang richtet sich nach den Kräften und der Lebensstellung des Kindes, also nach Alter, gesundheitlicher Konstitution und sonstigen Lebensumständen. Dabei gibt es keine Zwangsmittel: eine zwangsweise Durchsetzung scheidet aus, und die Verweigerung berechtigt die Eltern nicht, den Unterhalt zu streichen.
Die nachfolgende Tabelle fasst Richtwerte aus der Rechtsprechung und typische Aufgaben zusammen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
Altersgruppe bis ca. 12/13 Jahre
- Dauer: etwa 3,5 bis 7 Stunden/Woche
- Tätigkeit: Zimmer aufräumen, Tisch decken und abräumen, Wäsche in den Korb legen, Spielzeug einsortieren, Blumen gießen
Altersgruppe ab ca. 14 Jahre
- Dauer: etwa 7 bis 8 Stunden/Woche
- Tätigkeit: Spülmaschine aus‑ und einräumen, Staubsaugen, Bad reinigen, Mülltonne herausstellen, Rasen mähen, gelegentliche Hilfe im Laden, Büro oder Hof der Eltern
Altersgruppe: volljährige Kinder
Die im Elternhaus leben und von den Eltern unterhalten werden Übernahme von Wochenenddiensten, Einkäufe erledigen, Handwerksarbeiten im Familienbetrieb – soweit sie die eigene Ausbildung oder Erwerbstätigkeit nicht beeinträchtigen
Grenzen und Schutzmechanismen
Anders als manche Schlagzeile suggeriert, ist § 1619 BGB kein Freibrief für Kinderarbeit. Die Vorschrift enthält mehrere eingebaute Schutzmechanismen:
- Verhältnismäßigkeit: Die Arbeit muss der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit des Kindes entsprechen.
- Rücksicht auf Bildung: Eltern müssen sicherstellen, dass die Mitarbeit die schulische oder berufliche Ausbildung nicht beeinträchtigt.
- Begrenzung durch das Jugendarbeitsschutzgesetz: Minderjährige dürfen nur geringfügige Hilfstätigkeiten verrichten; gefährliche Arbeiten sind verboten. Bei älteren Jugendlichen lockern sich diese Beschränkungen stufenweise.
- Keine Zwangsvollstreckung: Gerichte können eine Leistung nach § 1619 BGB nicht durch Zwangsmittel durchsetzen. Eltern können also weder mit Geldstrafen noch mit Freiheitsentzug drohen.
- Ende der Pflicht bei eigener Existenzsicherung: Wer seine Arbeitskraft vollständig in eine entgeltliche Tätigkeit steckt, ist von der Dienstpflicht befreit.
Fazit
§ 1619 BGB ist eines der letzten Relikte einer Zeit, in der die Arbeitskraft der Kinder wirtschaftliche Bedeutung hatte. Heute soll die Vorschrift eher das gegenseitige Verantwortungsgefühl in Familien stärken. Die meisten Gerichte sehen die Norm nur noch im Schadens- und Erbrecht als relevant. Sie kann aber als „Weckruf“ dienen, wenn sich die familiäre Arbeitsteilung zu sehr auf die Eltern verlagert. Die Dienstpflicht ist begrenzt: Sie endet, sobald das Kind seinen Unterhalt selbst verdient oder aus dem Elternhaus auszieht. Wer das nächste Mal mit seinem Nachwuchs über Pflichten streitet, kann also gelassen bleiben – und die Diskussion vielleicht mit einem Hinweis auf die alte Norm aus dem BGB würzen.
Quellen:
de.wikipedia.org
dejure.org
gesetze-im-internet.de
haufe.de
orgamax.de